- Beitritt
- 12.05.11
- Beiträge
- 10.076
Ja, offenbar schon. Erregerpersistenz dürfte eher die Ausnahme sein.Die Frage ist, ob auch ohne diesen Trigger einer Erregerpersistenz eine Immunantwort lebenslänglich erhalten bleiben kann.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Ja, offenbar schon. Erregerpersistenz dürfte eher die Ausnahme sein.Die Frage ist, ob auch ohne diesen Trigger einer Erregerpersistenz eine Immunantwort lebenslänglich erhalten bleiben kann.
als ich das letzte mal an einer virusgrippe (influenza) erkrankt war, hatte ich 2 tage über 39 fieber und es ging mir sehr schlecht, also war es keine leichte erkrankung und es war auch nicht das erste mal, daß ich eine virusgrippe (influenza) hatte.
Ich zweifle an deinen Behauptungen.
wegen 39° fieber muss man nicht ins krankenhaus.
das hab ich auch nie behauptet.
aber bei über 39 grad fieber ist es auch keine leichte erkrankung.
Wo ist denn jetzt das Problem das jeweilige (Lehr-)buch zu zitieren samt Seitenangabe und ggfs. die betreffende Buchseite hier gescannt einzustellen? Oder wurde das schon gemacht?
usw...4.10.3 Antikörperabhängige zellvermittelte
Zytotoxizität
NK-Zellen besitzen Fc-Rezeptoren für IgG-Antikörper
(7 Kap. 2). Sie können daher antikörperbeladene
Wirtszellen über das Fc-Stück des gebundenen Ig
erkennen. Diese Reaktion bewirkt beim erkennenden
Lymphozyten die Sekretion zytolytischer Moleküle,
welche die beladene Zelle abtöten (7 Kap. 8).
Die antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxi
zität (»antibody dependent cellular cytotoxicity«,
ADCC) spielt bei der Tumor- und Virusabwehr sowie
bei bestimmten Parasitenerkrankungen eine
Rolle.
4.10.4 Komplementaktivierung
Die Antigen-Antikörper-Reaktion führt häufig
zur Aktivierung des Komplementsystems (7 Kap. 5);
hier sei zunächst nur auf die Folgen der Komplementaktivierung
hingewiesen:
4 Bakteriolyse
4 Virusneutralisation
4 Opsonisierung
4 Anlockung von Entzündungszellen
4.10.5 Allergische Sofortreaktion
IgE-Moleküle, die über ihren Fc-Teil an Eosino phile
oder Basophile oder an Mastzellen gebunden sind,
können mit dem homologen Antigen reagieren; dies
führt zu einer allergischen Sofortreaktion (7 Kap. 10).
4.10.6 Immunkomplexbildung in vivo
In Antigen-Antikörper-Komplexen, die in vivo
unter den Bedingungen der Äquivalenz oder des
Antikörperüberschusses entstehen (7 Kap. 6), bleiben
zahlreiche Fc-Stücke frei. Dementsprechend
können die Immunkomplexe über ihre Fc-Rezeptoren
phagozytiert und abgebaut werden (7 Kap. 10).
Abb. 4.5 Verlauf der B-Zell-Antwort vom Erstkontakt mit Antigen zum immunologischen Gedächtnis
Entstehen Antigen-Antikörper-Komplexe dagegen
bei Antigenüberschuss, so ist die Phagozytosefähigkeit
gering. Denn jeder Komplex trägt unter
diesen Bedingungen nur wenige Antikörpermoleküle.
Solche Komplexe werden schlecht abgebaut.
Ihre Ablagerung in Haut, Nieren oder Gelenkräumen
kann zu schwerwiegenden Entzündungsreaktionen
und Gewebeschädigungen führen (7 Kap. 10).
4.11 Klonale Selektionstheorie:
Erklärung der Antikörpervielfalt
Da sich der Säugerorganismus während seines
Lebens mit einer Vielzahl diverser Antigene auseinanderzusetzen
hat, muss er eine riesige Zahl
unterschiedlicher Antikörper produzieren können.
Die klonale Selektionstheorie (Burnet) erklärt das
Problem der Antikörpervielfalt.
In einer frühen Entwicklungsphase der BLympho
zyten entstehen Zellen unterschiedlicher
Spezifität. Die Diversität ent wickelt sich vor der
Erstkonfrontation mit dem Antigen ohne jeden Antigeneinfluss.
Die entstandenen Zellen exprimieren
jeweils Rezeptoren einer einzigen Spezifität. Der
spätere Erstkontakt mit dem komplementären
Antigen bewirkt die selektive Vermehrung und
Differenzierung der Zellen. Man kann sich diesen
Sachverhalt so vorstellen, dass das Antigen unter
den B-Zellen eine Wahl (Selektion) trifft, indem es
mit den zuständigen Zellen reagiert (. Abb. 4.4).
Unter dem Einfluss des Antigens entstehen
zum einen Plasmazellen, die Antikörper der ursprünglichen
Spezifität produzieren; beim Erstkontakt
mit dem Antigen bilden diese Zellen
hauptsächlich Antikörper der IgM-Klasse. Durch
Ig-Klassenwechsel entstehen Plasmazellen, die
Antikörper einer bestimmten Ig-Klasse sezernieren.
Zum anderen entstehen im Rahmen der Primärantwort
Gedächtniszellen; diese sind dafür
verantwortlich, dass sich nach Zweitkontakt mit
dem gleichen Antigen rasch Plasmazellen entwickeln,
die jetzt Antikörper derselben Ig-Klasse
sezernieren (. Abb. 4.5).
Demnach existiert für jedes Antigen bereits vor
dem Antigenerstkontakt eine bestimmte Anzahl
zuständiger (komplementärer) Zellen. Die Nachkommen
einer antigenspezifischen Zelle werden als
Klon bezeichnet. Unter dem Einfluss des Antigens
kommt es zur klonalen Expansion und Differenzierung.
Somit wird die humorale Immunantwort
beim Zweitkontakt mit einem Erreger von 2 B-Zell-
Typen getragen:
4 Plasmazellen, die sich nicht mehr vermehren,
dafür aber große Antikörpermengen (> 100
Moleküle/s) sezernieren, die mit dem Erreger
sofort reagieren. Die bereits exis tierenden
Serumantikörper sind für die rasche Neutralisation
hochwirksamer Erregerprodukte,
z. B. Toxine, entscheidend.
5 Kurzlebige Plasmazellen sind für die
prompte Antikörperantwort zuständig.
5 Langlebige Plasmazellen garantieren
eine lang anhal tende Immunantwort.
4 Gedächtnis-B-Lymphozyt en, die selbst keine
Antikörper produzieren, sich nach Zweitkontakt
mit dem Erregerantigen aber rasch
vermehren und in Plasmazellen ausreifen.
Der rasche Antikörperanstieg nach Zweitkontakt
ist auf die Differenzierung der Gedächtnis-
B-Zellen zu antikörperproduzierenden
Plasmazellen zurückzuführen.
Die klonale Selektionstheorie ist experimentell
be stätigt worden; heute stellt sie ein Dogma der Immunologie
dar. Im Prinzip gelten die geschilderten
Vorgänge auch für die zelluläre Immunität.
4.11.1 Toleranz gegen Selbst
und klonale Selektionstheorie
Während das Immunsystem alle möglichen Fremdantigene
zu erkennen vermag, ist es normalerweise
unfähig, mit körper eigenen Molekülen, sog. Autoantigen
en, zu reagieren. Auf die Bedeutung dieser
»Toleranz gegen Selbst« hatte bereits Paul Ehrlich
hingewiesen und dafür den Begriff des »Horror
autotoxicus« geprägt. Heute wissen wir, dass die
Toleranz gegenüber Autoantigenen nicht a priori
festgelegt ist; sie wird während einer frühen Phase
der Embryonalentwicklung erworben.
Vereinfacht lässt sich sagen: Das ursprüngliche
Zuständigkeitsrepertoire erstreckt sich auch auf
Autoantigene. Während einer frühen Entwicklungsphase
kommt es zum Kontakt zwischen den autoreaktiven
B-Zell-Vorläufern und dem Auto anti gen.
Anders als bei der reifen B-Zelle bewirkt der Antigenkontakt
in dieser Situation keine klo nale Expansion
und Differenzierung, sondern im Gegenteil die
Inaktivierung der erkennenden Zellen (7 Kap. 10).
Offen bleibt, ob es sich bei diesem Vorgang um die
materielle Eliminierung oder nur um eine funktionelle
Blockade autoreaktiver Klone handelt.
Bestimmte Autoimmunerkrankungen scheinen
allerdings darauf zurückzuführen zu sein, dass
ein Klon mit Spezifität für ein körpereigenes Antigen
entblockt wird und anschließend expandiert.
Der nun ungezügelte Klon produziert dann Autoantikörper
und verursacht autoaggressive Reaktionen
(7 Kap. 10). Bei der Basedow-Krankheit werden
z. B. Antikörper gebildet, welche die Schilddrüse
zur vermehrten Hormonproduktion anregen. Im
Experiment lässt sich sogar bei erwachsenen Tieren
mit einem sonst immunogen wirkenden Antigen
Toleranz in duzieren. Somit kann ein und dasselbe
Antigen je nach Art der Umstände entweder immunogene
oder toleranzinduzierende (tolerogene)
Wirkung entfalten.
4.12 Genetische Grundlagen
der Antikörperbildung
Beim immunkompetenten Individuum ist die BZell-
Population uneinheitlich: Sie besteht aus einer
großen Zahl (etwa 109) genetisch diverser Klone,
die sich durch die Erkennungsspezifität des Antikörpers
unterscheiden, den die Zelle synthetisiert.
Ein gegebener Klon kann nur Antikörper einer einzigen
Spezifität bilden; seine diesbezügliche Kompetenz
ist unwiderruflich festgelegt (»committed
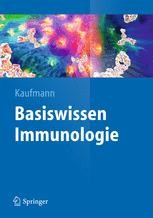
Wir vier Geschwister, Jahrgang 1932-1938, wurden zwar mit den Pflichtimpfumgen gegen Pocken und Diphterie geimpft, bekamen aber sonst die üblichen Kinderkrankheiten: Masern, Keuchhusten, Röteln, Windpocken, Mumps. Wir wurden mit Hausmitteln behandelt und waren nach einer Woche wieder gesund. Heute wird gegen alles geimpft, und die Krankheiten scheinen dadurch gefährlicher geworden zu sein. Dass ich trotz Alter offenbar noch ein funktionierendes Immunsystem habe, verdanke ich vielleicht diesen Kinderkrankheiten, vielleicht auch der Zeit der Evakuiierung auf der schwäbischen Alb, als ich mich gern in Kuhställen herumgetrieben habe unter hygienisch fragwürdigen Umständen.leute etwa, die als kinder schon gegen kinderkrankheiten geimpft wurden,
so dass die erkrankung dabei unterdrückt wurde, haben als erwachsene in der regel kein besonders ausgeprägtes immunsystem. wenn sie sich dann auch noch regelmässig gegen grippe impfen lassen..
Aber wie in jedem Lehr- oder Sachbuch gibt es doch wichtigere und weniger wichtige Stellen, die man sich anstreicht, unterstreicht, oder eben markiert. Mit Textmarker, oder mit Fettschrift, zum Beispiel. Um bestimmte Punkte zu verstehen, muss man doch letztlich nicht ein Lehrbuchkapitel auswendig lernen. Natürlich ist es dann gut und auch wichtig, die Zusammenhänge zu sehen, zu lesen, zu verstehen, aber um etwas auch mal wiedergeben zu können, auch für sich selber, um vielleicht weiter darüber nachdenken zu können, baucht man die entscheidenden, je nachdem Schlüsselstellen. Zum Beispiel. So macht es doch jeder Student. Nur die allerwenigsten können ganze Lehrbücher komplett repetieren.man müsste es schon zusammenhängend durchgehen,
weil das eine auf das andere aufgebaut ist und es da systematisch entwickelt wird.
wie in einem lehrbuch eben.
Nach meiner Beobachtung hat ein jeder derjenigen, die ganze Lehrbücher auswendig gelernt wortwörtlich wiederzugeben vermögen, von all dem nichts verstanden. - Man muß es nur wagen, hierzu Verständnisfragen zu stellen.Nur die allerwenigsten können ganze Lehrbücher komplett repetieren.
(ohne genauere Angabe, was "lang" konkret bedeutet)Langlebige Plasmazellen garantieren eine lang anhaltende Immunantwort.
die durch solche vermittelte immunität hält auch ein leben lang, da sie
von den gedächtniszellen immer wieder neu gebildet werden können.
und das machst du draus:
Einleitung
Das Überstehen einer Infektionskrankheit verleiht
dem Genesenen häufig Schutz vor deren Wiederholung.
Wer einmal an Masern erkrankte, ist für den
Rest seines Lebens masernunempfänglich. Diese
Eigenschaft ist nicht angeboren, sondern erworben:
Jeder Mensch ist nach seiner Geburt empfänglich
für Masern; die Resistenz entsteht erst durch die
Krankheit selbst. Hierfür ist das Immunsystem zuständig.
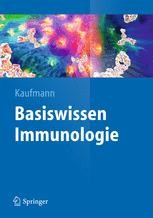
Basiswissen Immunologie
Die Immunologie fließt in zahlreiche medizinische Fachgebiete ein. Hierzu zählen beispielsweise Transplantation, Tumorabwehr, chronische Entzündung und Autoimmunität. Als Auszug aus dem Lehrbuch "Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie" liefert das Basiswissen Immunologie eine ideale...link.springer.com
Aber wie in jedem Lehr- oder Sachbuch gibt es doch wichtigere und weniger wichtige Stellen, die man sich anstreicht, unterstreicht, oder eben markiert. Mit Textmarker, oder mit Fettschrift, zum Beispiel. Um bestimmte Punkte zu verstehen, muss man doch letztlich nicht ein Lehrbuchkapitel auswendig lernen. Natürlich ist es dann gut und auch wichtig, die Zusammenhänge zu sehen, zu lesen, zu verstehen, aber um etwas auch mal wiedergeben zu können, auch für sich selber, um vielleicht weiter darüber nachdenken zu können, baucht man die entscheidenden, je nachdem Schlüsselstellen. Zum Beispiel. So macht es doch jeder Student. Nur die allerwenigsten können ganze Lehrbücher komplett repetieren.
Es heißt an der Stelle:
Masern werden danach als Beispiel genannt.Das Überstehen einer Infektionskrankheit verleiht ... häufig Schutz vor Wiederholung.
"Häufig" heißt auf jeden Fall nicht nur in 1 Fall, aber auch nicht in jedem Fall.
Das müsste im weiteren des Buches eigentlich noch weiter ausgeführt werden.
aus Kaufmanns Buch (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-40325-5)Das Überstehen einer Infektionskrankheit verleiht dem Genesenen häufig Schutz vor deren Wiederholung. Wer einmal an Masern erkrankte, ist für den
Rest seines Lebens masernunempfänglich.

allgemein gesprochen, also gibt es wohl mehrere, an die er denkt, sonst hätte er hier schon "Masern" geschrieben.Einleitung
Das Überstehen einer Infektionskrankheit ...
Immer noch nichts von Masern, weiterhin allgemein.... verleiht dem Genesenen häufig Schutz vor deren Wiederholung.
Ich mein, es ist weiterhin eine kurze Einleitung. Auch wenn da nicht steht 'zum Beispiel' ist es doch relativ deutlich ein Beispiel für das vorher, allgemein, Gesagte.Wer einmal an Masern erkrankte ...
Ich halte sie auch für unwahrscheinlich, und ich bin Sprachwissenschaftlerin und habe täglich mit wissenschaftlichen Texten zu tun, schreibe sie auch selbst.Die zweite Möglichkeit halte ich für unwahrscheinlich. Ich bin keine Sprachwissenschaftlerin, es sind einfach nur meine Gedanken.
Ich schrieb ja, dass ich Möglichkeit 2 für unwahrscheinlich (aber eben nicht ausgeschlossen) halte. Wie offenbar auch MalvegilAls Wissenschaftler wird er mit Sicherheit zwischen häufig, immer, selten, oder nur in einem ganz besonders speziellen Fall, zu unterscheiden wissen.
Ich halte sie auch für unwahrscheinlich,...
Vorsicht: Von anderen Fachbereichen weiß ich, daß die Einleitungswissenschaft einer bestimmten Disziplin bzw. Thematik nicht selten wichtiger ist als das, was jeweils im Hauptteil abgehandelt wird, dies deshalb, weil hier das jeweilige Vorverständnis abgeklärt wird, ohne das alles im Hauptteil Abgehandelte unverständlich bleiben muß oder Anlaß zu falschen und damit verfehlten Schlußfolgerungen gibt.Ansonsten fragte ich mich schon vorhin, welcher Student wohl jemals die Zeit hat, tagelang über die ersten beiden Sätze der EINLEITUNG nachzudenken - falls die dann überhaupt (an)gelesen wird.
'Zur Sache' geht es ja erst im Hauptteil.