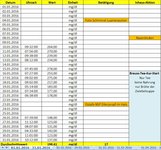nullzero
Temporär gesperrt
Themenstarter
- Beitritt
- 13.08.16
- Beiträge
- 784
Wer Interesse hat, hier eine neue Veröffentlichung, eine Zusammenfassung von Virulenzfaktoren der Staphylokokkenkeime die in dem vom Verlag Taylor & Francis veröffentlichen Jounal Virulence in der 12-Dezember-Ausgabe erscheinen wird.
Pathogenicity and virulence of Staphylococcus aureus.
Die Originaldatei ist wie immer als PDF verfügbar.
Eine Übersetzte Version ist hier aufrufbar.
Pathogenität und Virulenz von Staphylococcus aureus
In der deutschen Übersetzung sind leider keine Bilddarstellungen sichtbar.
Hier ein Auszug der Teil mit den Ansteckungsursachen.
Ansteckungsursachen
Der Überblick über den Keim ist ganz gut, dass hier auch schon das Histamin und das Mastzellenproblem mit erwähnt wird. Wovon es aber bessere Studien und Informationen dazu gibt, weil hier immer das hochgiftige PVL-Toxin im Zusammenhang mit dem Biofilm ursächlich ist. Was aus meiner Sicht fehlt ist die Maskierung im die CWD-Form, denn es gibt hierzu eine ganze Anzahl von Studien. Vielleicht ist die CWD-Form der Schulmedizin nicht so zugänglich, weil ja der Ursprung von Hahnemann etc. genannt wurde. Kommt wohl wie immer auf das umfassende Wissen und die Priorität in Veröffentlichungen mit darauf an.
Gruß Nullzero
Pathogenicity and virulence of Staphylococcus aureus.
Die Originaldatei ist wie immer als PDF verfügbar.
Eine Übersetzte Version ist hier aufrufbar.
Pathogenität und Virulenz von Staphylococcus aureus
In der deutschen Übersetzung sind leider keine Bilddarstellungen sichtbar.
Hier ein Auszug der Teil mit den Ansteckungsursachen.
Ansteckungsursachen
S. aureus- Infektionen gehen in der Regel auf eine asymptomatische Besiedelung oder, wahrscheinlich seltener und insbesondere im Krankenhausumfeld, auf infizierte Erreger oder Übertragung von anderen Personen zurück [ 24 , 25 ]. Mehrere Studien haben über Assoziationen der Kolonisierung verschiedener Körperstellen mit invasiven Infektionen berichtet [ 24 , 26 , 27 ]. Die Nasenlöcher gelten traditionell als Hauptkolonisationsgebiet von S. aureus , aber S. aureuskann neben dem Darm viele Hautstellen besiedeln. Eine anhaltende Kolonisation tritt nur in einer Untergruppe der Bevölkerung auf, die je nach Studie zwischen 10 und 30 % liegt. Die Besiedlung verschiedener Körperstellen ist normalerweise stark korreliert. Es wird angenommen, dass diese Korrelation auf häufiges Berühren und Nasenbohren und die daraus resultierende Verteilung zurückzuführen ist [ 28 , 29 ]. S. aureus kann auch von Tieren erworben werden, insbesondere in der Nutztierindustrie, wo die Entwicklung von Nutztier-assoziierten MRSA (LA-MRSA) von großer Bedeutung war. Außerhalb dieses Rahmens werden LA-MRSA-Stämme jedoch nicht als Hauptverursacher von MRSA-Infektionen beim Menschen angesehen [ 30 ].
Eine systemische S. aureus- Infektion ist immer von einer bakteriellen Durchbrechung der epithelialen Schutzschicht abhängig. Hautinfektionen können sich beispielsweise aus kleinen Hautkratzern entwickeln und invasiv werden [ 31 ]. Jedoch S. aureus kann auch epitheliale Verletzung aktiv fördern, für die α-Toxin hat überwiegend durch seine Aktivierung des Metalloproteinase - Domäne-enthaltendes Proteins 10 (ADAM10) verantwortlich abzuspalten E-Cadherin - Moleküle vorliegen [ 32 , 33 ]. Dieser Mechanismus bricht adhärente Verbindungen und beeinträchtigt das Aktin-Zytoskelett [ 34 ] (Abbildung 1).
Die Kontamination von im Inneren befindlichen Medizinprodukten stellt einen weiteren Infektionsweg dar, der im Krankenhausumfeld häufig vorkommt. Der Hauptmechanismus, der diesem Infektionsweg zugrunde liegt, ist die Fähigkeit von S. aureus , an dem Kunststoffmaterial der Geräte sowie an den Matrixmolekülen, die die Geräte kurz nach dem Einsetzen bedecken, zu haften und einen Biofilm auf dem Gerät zu bilden [ 19 ]. Biofilmbildung ist auch die vermutete Ursache für das menstruelle Staphylokokken-Toxic-Shock-Syndrom (TSS), bei dem bestimmte S. aureus- Stämme, die das Toxic-Shock-Syndrom-Toxin-1 (TSST-1) produzieren, Biofilme auf hochabsorbierenden Tampons bilden [ 35 ].
Eine Lebensmittelvergiftung ist ein Sonderfall einer akuten S. aureus- Infektion, bei der kontaminierte Lebensmittel mit Staphylokokken-Enterotoxinen (SE) aufgenommen werden [ 36 ]. SEs verursachen in nicht vollständig verstandener Weise Erbrechen, das eine Induktion der Histaminfreisetzung aus Darmmastzellen beinhaltet [ 37 ]. Ähnlich wie TSST-1 handelt es sich um superantigene Toxine, die T-Zellen überwiegend unspezifisch aktivieren, was zu einer überschießenden Immunantwort führt, die eine polyklonale T-Zell-Aktivierung und eine massive Zytokinfreisetzung beinhaltet. Systemische Infektionen durch akute Staphylokokken-Lebensmittelvergiftung sind sehr selten. Ob anhaltende Darmbesiedelung durch S. aureuszu gastrointestinalen und sogar systemischen Erkrankungen führen kann, ist nicht bekannt. Die beobachtete Korrelation zwischen der intestinalen S.-aureus- Kolonisation und anderen Formen der S.-aureus- Infektion beruht wahrscheinlich eher darauf, dass der Darm ein Reservoir für die Verteilung von S. aureus auf andere epitheliale Kolonisationsstellen darstellt [ 26 ].
Schließlich kann S. aureus auch den Primärschaden anderer Erreger oder prädisponierende Zustände opportunistisch nutzen. Dies tritt beispielsweise bei Lungeninfektionen auf, die durch eine Virusinfektion wie die Grippe ausgelöst wurden, bei denen eine S. aureus- Sekundärinfektion oft die letzte Todesursache ist [ 38 , 39 ]. Darüber hinaus hat sich gezeigt , dass S. aureus über spezifische Toxine, einschließlich -Toxin oder ähnliche zytolytische Peptide, die als phenollösliche Moduline (PSMs) bezeichnet werden, durch die Aktivierung von Mastzellen zur Entwicklung von atopischer Dermatitis beiträgt [ 7 , 40 , 41 ]. Außerdem ist S. aureus kann Hautinfektionen durch andere Krankheitserreger komplizieren. Ein solches Beispiel ist die Exazerbation von Buruli-Ulzera, auch nachdem der ursprüngliche Erreger (hier Mycobacterium ulcerans ) durch eine antibiotische Behandlung ausgerottet wurde [ 42 ].
Der Überblick über den Keim ist ganz gut, dass hier auch schon das Histamin und das Mastzellenproblem mit erwähnt wird. Wovon es aber bessere Studien und Informationen dazu gibt, weil hier immer das hochgiftige PVL-Toxin im Zusammenhang mit dem Biofilm ursächlich ist. Was aus meiner Sicht fehlt ist die Maskierung im die CWD-Form, denn es gibt hierzu eine ganze Anzahl von Studien. Vielleicht ist die CWD-Form der Schulmedizin nicht so zugänglich, weil ja der Ursprung von Hahnemann etc. genannt wurde. Kommt wohl wie immer auf das umfassende Wissen und die Priorität in Veröffentlichungen mit darauf an.
Gruß Nullzero