zurück
Menu
Install the app
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Postoperatives Delir (früher: Durchgangssyndrom)
- Themenstarter Oregano
- Erstellt am
-
- Schlagworte
- delir durchgangssyndrom operation postoperativ übergangssyndrom
- Beitritt
- 20.05.08
- Beiträge
- 7.177
Besonders jene Patienten, die schon mal nach einer längeren Vollnarkose betroffen waren müssen das im Falle eines Falles unbedingt mit den Ärzten absprechen. Es handelt sich um einen schweren traumatischen Einschnitt, da man im Gegensatz zum Alptraum nicht zwischen Wirklichkeit und Horror unterscheiden kann. Ich weiß wovon ich spreche, denn ich habe das nach zweier längerer (über 8 Stunden) Vollnarkosen erleben müssen.
Themenstarter
- Beitritt
- 10.01.04
- Beiträge
- 74.181
Hier wird über das postoperatiave Delir und eine vermutete oder auch sicher "diagnostizierte" Demenz berichtet.
Bei jedem Menschen, der gerade eine Op hinter sich hat und Symptome einer Demenz zeigt, sollte immer auch an dieses postoperative Delir = Folgen der Operation mit Narkose, Schmerzmitteln usw. gedacht werden, damit nicht am Ende eine vollig falsche Konsequenz aus der falschen Diagnose gezogen wird.
Das ist dann besonders wichtig zu wissen, wenn für den Operierten eine Patientenbetreuung durch einen Laien vereinbart wurde! ...

 www.zentrum-der-gesundheit.de
www.zentrum-der-gesundheit.de
Grüsse,
Oregano
Bei jedem Menschen, der gerade eine Op hinter sich hat und Symptome einer Demenz zeigt, sollte immer auch an dieses postoperative Delir = Folgen der Operation mit Narkose, Schmerzmitteln usw. gedacht werden, damit nicht am Ende eine vollig falsche Konsequenz aus der falschen Diagnose gezogen wird.
Das ist dann besonders wichtig zu wissen, wenn für den Operierten eine Patientenbetreuung durch einen Laien vereinbart wurde! ...

Zu Hause gesund, im Krankenhaus plötzlich dement
Oft wird bei Menschen im Krankenhaus Demenz diagnostiziert. Häufig handelt es sich dabei um eine krankenhausbedingte Verwirrung - die zu Hause verschwindet.
Grüsse,
Oregano
Themenstarter
- Beitritt
- 10.01.04
- Beiträge
- 74.181
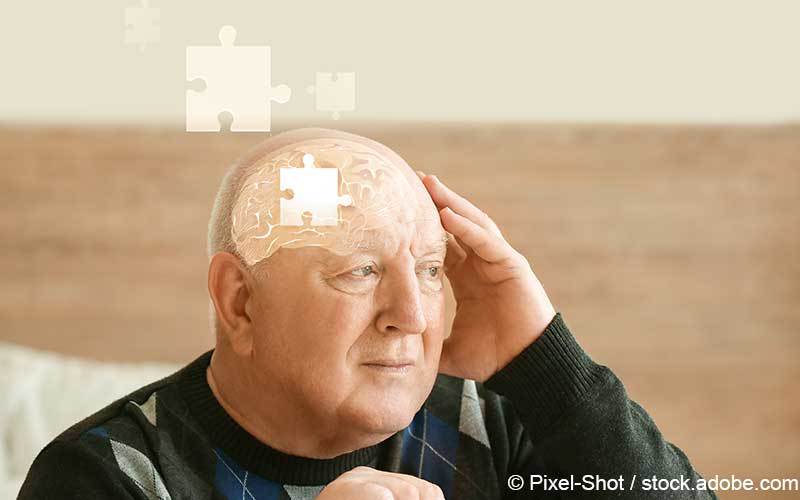
Nicht-medikamentöse Therapie des Delirs | Gelbe Liste
Die nicht-medikamentöse Therapie des Delirs ist in vielen Fällen der pharmakologischen Therapie nicht unterlegen. Ein aktueller Übersichtsartikel liefert einen guten Überblick.
Am besten ist es, wenn gar kein Delir eintritt, und dafür gibt es Vorsorgemaßnahmen...
...
Einem Delir vorbeugen
Zur Prävention eines Delirs kommen verschiedene nicht-medikamentöse Maßnahmen zum Einsatz. Den Patienten sollten Ankommen und Orientierung in der fremden Umgebung erleichtert werden. Hierzu tragen sogenannte reorientierende Interventionen bei – Ärzte und Pflegepersonal sollten sich mit Namen vorstellen, der Krankheitsverlauf sollte erörtert werden und, soweit möglich, sollten eine Uhr sowie ein Kalender vorhanden sein. Der zirkadiane Rhythmus sollte durch entsprechende Beleuchtung gefördert werden, sowohl Reizüberflutung als auch die Deprivation von Reizen sollten vermieden werden. Auch eine adäquate Analgesie, Frühmobilisation und die Anwesenheit von vertrauten Personen sind wichtig.
ABCDEF-Bündel zur Prävention
Die oben genannten Maßnahmen werden im ABCDEF-Bündel vereint, welches Roiter im Artikel zitiert. Die Buchstaben stehen für Schmerzmanagement (Analgesia), Atmung (Breathing), Auswahl von Medikamenten (Choice the Medication), Delirium-Management, Frühmobilisation und frühzeitige enterale Ernährung (Early Mobility, Enteral Nutrition) sowie vertraute Personen (Familiy and Friends). Dies wird auch in einer übersichtlichen Grafik dargestellt.
In einer zitierten Studie von Marra et al. [2] trug die Anwendung des ABCDEF-Schemas auf Intensivstationen zu einer besseren Interaktion von Intensivpatienten bei, da die Patienten durch eine adäquate Analgesie bereits früh an körperlichen und die Kognition fördernden Aktivitäten teilnehmen konnten.
Pharmakologische Therapie mit Zurückhaltung
Die Evidenzlage für eine nicht-medikamentöse Therapie des Delirs ist gut. Roiter empfiehlt daher: „Der generelle Einsatz von Pharmaka zur Delirtherapie soll äußerst zurückhaltend erfolgen.“
...
Grüsse,
Oregano
- Beitritt
- 24.10.05
- Beiträge
- 6.280
Dies ist alles recht und schön, mich entsetzt vor allem, wie schnell ältere Persönlichkeiten, die sich bis ins hohe Alter selbsttätig versorgen konnten, beispielsweise im Gefolge einer Oberschenkelhalsbruch-Operation im postoperativen Delir gestorben sind.
Alles Gute!
Gerold
Alles Gute!
Gerold
Themenstarter
- Beitritt
- 10.01.04
- Beiträge
- 74.181
...
Die randomisierte Studie untersuchte 1.470 Patienten ab einem Alter von 70 Jahren, die elektive orthopädische, kardiale oder andere chirurgische Eingriff hatten. Die Teilnehmenden wurden im Zeitraum von November 2017 bis April 2019 in fünf deutschen Zentren rekrutiert.
Zunächst erhielt das verantwortliche Personal der teilnehmenden Zentren eine entsprechende Schulung zu dem Delirpräventionsprogramm mit dem Namen AKTIVER (Alltags- und Kognitions-Training- Interdisziplinarität Verbessert das Ergebnis und mindert das Risiko). Die Verantwortlichen prüften das Delir-Risiko der Teilnehmenden täglich. Die Präventionsmaßnahmen wurden auf jeden Patienten individuell zugeschnitten. Mögliche Bestandteile sind: kognitive, motorische und sensorische Stimulation, Begleitung beim Essen und während diagnostischen Maßnahmen sowie Entspannung und Schlafförderung.
Als Haupt-Outcome wurden die Inzidenz des postoperativen Delirs sowie dessen Dauer definiert.
Ergebnisse
Die 1.470 Teilnehmenden waren im Durchschnitt 77 Jahre alt. Die Anwendung des Delir-Präventionsprogrammes AKTIVER reduzierte die Inzidenz des postoperativen Delirs (Odds Ratio [OR] 0,87; 95% Konfidenzintervall [CI] 0,77-0,98; p = 0,02). Kam es zum Auftreten eines Delirs, so war dessen Dauer im Vergleich zur Kontrollgruppe verkürzt (5,3% vs. 6,9%; p = 0,03).
Der Effekt war bei Patienten nach Abdominalchirurgie oder orthopädischen Eingriffen vorhanden (OR 0,59; 95% CI 0,35-0,99; p = 0,047), aber nicht bei Patienten mit einem chirurgischen Eingriff am Herzen (OR 1,18; 95% CI 0,70-1,99; p = 0,54).
Fazit
Das Delir-Präventionsprogramm AKTIVER führte in dieser Studie zu einer Reduktion des postoperativen Delirs bzw. zu einer Verkürzung der Delir-Dauer bei älteren Patienten nach verschiedenen chirurgischen Interventionen mit Ausnahme kardialer Eingriffe. Warum Herz-Patienten nicht von dem Programm profitierten, ist bisher unklar. ...

AKTIVER gegen das postoperative Delir | Gelbe Liste
Früherkennung und gezielte Präventionsmaßnahmen reduzieren das Risiko eines postoperativen Delirs, wie eine aktuelle Studie zeigt.
https://careum.ch/aktuell/delir-behandlungen-in-der-praxis...
Aktuell bevorzugte Richtlinien
...
- Deutsche S3-Richtlinien 2015
- ABCDEF-Bundle 2017
- PAD-Management Richtlinien 2013 (pad-management.de/archive_3/10-punkte.html)
- NICE- Management Richtlinien 2014
- Clinical Practice Guidelines 2013
Eine erfolgreiche Delirbehandlung erfodert ein Umdenken aller beteiligten Fachdisziplinen. Die ESA-Guideline der European Society of Anästhesiology stellt den neurologischen Behandlungserfolg während und nach einer Operation erstmalig in den Fokus und nimmt alle Teilnehmenden in die Pflicht, ihren Beitrag zu leisten.
In einem Team von Gleichgestellten kann die medizinische Versorgung schwerkranker Patientinnen und Patienten verbessert werden.
...
Externe Ressourcen können einen entscheidenden Beitrag leisten, wenn sie in die Behandlung miteinbezogen werden. Die Physiotherapie könnte das Mobilisationskonzept umsetzen.
Eine Stationsapothekerin oder ein Stationsapotheker optimiert die medikamentöse Versorgung und erkennt Medikamente, die ein Delir verschlimmern oder auslösen (Klopotowska u. a., 2010); (TEAM Study Investigators u. a., 2015).
Angehörige nicht vergessen!
Angehörie stellen eine wichtige Ressource dar und sollten soweit wie möglich in die Behandlung und den Informationsprozess miteinbezogen werden. Eine klare Empfehlung aufgrund der schwachen Evidenz ist in der Literatur nicht zu finden.
Jedoch deuten aktuelle Studien im Bereich der Delirprävention auf eine Verbesserung der Situation hin (Rosa u. a., 2017). Zudem verweisen Fachexpertinnen und Fachexperten immer wieder auf die Bedeutung der Rolle von Angehörigen.
Die verstärkte familiäre Einbindung ist zum Beispiel im ABCDEF Family Bundle und in dem Konzept der familienzentrierten Pflege verankert. Das ABCDEF-Bündel ist ein Konzept zur Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Delir.
Einen Anfang machen!
10 Tipps für eine bessere Intensivbehandlung
(Falthauser, o. J.)
- Verstärkte Einbindung der Angehörigen – Verlängerung der Besuchszeiten
- Konsequenter Einsatz von Hilfsmitteln (Brille, Hörgerät usw.)
- Lange nächtliche Ruhephasen für Patientinnen und Patienten
- Verringern der Monitoralarme
- Keine lärmintensive Arbeitsabläufe in der direkter Patientenumgebung
- Ohrstöpsel und Schlafmasken nutzen
- Patientinnen und Patienten Tageslicht gönnen
- Konsequente, möglichst aktive Frühmobilisation
- Vermeidung von Benzodiazepinen
- Delir therapieren, wenn es auftritt
Es gibt noch viel zu tun
Die Belastung für das medizinische Personal und die betroffenen Personen ist hoch. Die aktuellen Richtlinien können zu einer Verbesserung der Situation für alle Beteiligten führen. Die Umsetzung liegt trotz der erbrachten Evidenz nach wie vor weit hinter den Erwartungen. ...
... Der 4A-Test ist einfach und schnell (<2 Minuten), benötigt keine Vorkenntnisse oder spezifische Schulung; bei Anwendung durch eine Pflegefachperson (oder Angehörige) kann jedoch eine Schulung sinnvoll sein, da so die Sensitivität erhöht werden kann [16–18]. Dabei werden die Wachheit («alertness»), Orientierung («Abbreviated Mental Test-4»: Alter, Geburtsdatum, Ort, Jahr), Aufmerksamkeit («attention») und die akute Änderung oder Fluktuation der Symptomatik («acute change or fluctuating course») beurteilt. Bei einer möglichen Punktzahl zwischen 0–12 weisen 4 Punkte auf ein Delir hin mit oder ohne kognitive Beeinträchtigung [19].


Das akute Delir während der Akuthospitalisation
In diesem Artikel wird anhand der aktuellen Evidenz ein klinischer Algorithmus für die Prävention, das Screening und die Behandlung eines Delirs während einer akuten Hospitalisation diskutiert.
Grüsse,
Oregano
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
- Beitritt
- 17.03.16
- Beiträge
- 3.301
Meine Tochter machte während ihres Psychologiestudiums Studien in einem Altenheim in den USA. Dort traf sie eine Patientin, die den größten Teil ihres Lebens in den USA verbracht hatte, aber aus Deutschland stammte. Diese war überglücklich, mit meiner Tochter deutsch sprechen zu können, da sie kein Englisch mehr verstand. Ihre ursprüngliche Muttersprache war noch vorhanden.
Themenstarter
- Beitritt
- 10.01.04
- Beiträge
- 74.181
... Dr. Nina C. Andersen-Ranberg vom Zealand University Hospital in Køge, Dänemark, und Kollegen teilten 1.000 erwachsene Patienten mit Delirium, die wegen einer akuten Erkrankung in die Intensivstation eingeliefert worden waren, nach dem Zufallsprinzip Haloperidol oder Placebo zu (510 bzw. 490). Von diesen Patienten wurden 501 bzw. 486 in die endgültigen Analysen einbezogen.
„Die Verwendung von Haloperidol führte nicht zu einer signifikant höheren Anzahl von Tagen, an denen die Patienten nach 90 Tagen noch lebten und außerhalb des Krankenhauses waren, als Placebo“, schreiben die Autoren.
- Die Forscher fanden heraus, dass nach 90 Tagen die durchschnittliche Anzahl der Tage, die die Patienten noch lebten und außerhalb des Krankenhaus waren, in der Haloperidol- 35,8 bzw. in der Placebogruppe 32,9 betrug (bereinigter mittlerer Unterschied: 2,9 Tage; 95-Prozent-Konfidenzintervall: -1,2 bis 7,0; P = 0,22).
- Die Neunzig-Tage-Mortalität lag in der Haloperidol- bei 36,3 Prozent und in der Placebogruppe bei 43,3 Prozent (bereinigte absolute Differenz: -6,9 Prozentpunkte; 95-Prozent-Konfidenzintervall: -13,0 bis -0,6).
- Schwerwiegende unerwünschte Wirkungen traten bei 11 in der Haloperidol- bzw. neun in der Placebogruppe auf.
...
Mehr zu Haloperidol: https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffe/Haloperidol_902#Anwendung
Grüsse,
Oregano
Themenstarter
- Beitritt
- 10.01.04
- Beiträge
- 74.181
Ein weiterer Artikel zum postoperativen Delir:

 www.gesundheit.de
www.gesundheit.de
Eine Operation bedeutet immer ein gewisses Risiko. - Ich kann mich nicht daran erinnern, daß beim vor-operativen Gespräch mit dem Anästhesisten überhaupt auf das Risiko des postoperativen Delirs hingewiesen wurde.
Grüsse,
Oregano

Delir: Ursachen & Symptome eines Deliriums
Ein Delir wird auch als Delirium oder Durchgangssyndrom bezeichnet und tritt oft nach einer OP auf. Was ist ein Delir genau, welche Ursachen gibt es u
Eine Operation bedeutet immer ein gewisses Risiko. - Ich kann mich nicht daran erinnern, daß beim vor-operativen Gespräch mit dem Anästhesisten überhaupt auf das Risiko des postoperativen Delirs hingewiesen wurde.
Grüsse,
Oregano
Themenstarter
- Beitritt
- 10.01.04
- Beiträge
- 74.181
...
Delir: „Ein Paradigmenwechsel muss her!“
„Da müssen die Patienten halt durch und danach ist alles wie früher“ – das war lange das Credo beim Delir. Heute weiß man, dass das nicht stimmt. Wie man das Delir erkennt, ihm vorbeugt und es richtig behandelt, erfahrt ihr hier.

Delir: „Ein Paradigmenwechsel muss her!“
„Da müssen die Patienten halt durch und danach ist alles wie früher“ – das war lange das Credo beim Delir. Heute weiß man, dass das nicht stimmt. Wie man das Delir erkennt, ihm vorbeugt und es richtig behandelt, erfahrt ihr hier.
Grüsse,
Oregano
Themenstarter
- Beitritt
- 10.01.04
- Beiträge
- 74.181
Wenn es möglich ist, sollte vor einer Operation mit den entsprechenden Ärzten beim Vorgespräch unbedingt auch über im Krankenhaus bekannte und durchgeführte Maßnahmen bei einem auftretenden Delir gesprochen werden.
Dabei kann dieses Video sehr nützlich sein.
Für den Fall, daß man eine Operation machen lassen muß, kann man sich nur wünschen, daß man in ein Krankenhaus kommt, das über dieses Delir Bescheid weiß und auch personell so ausgestattet ist, daß solche Maßnahmen überhaupt durchgeführt werden können.
Grüsse,
Oregano
Dabei kann dieses Video sehr nützlich sein.
... Delir und Delirprävention
Ein Delir ist eine akute Veränderung in Verhalten, Bewusstsein und Aufmerksamkeit des Patienten, die sich in Wesens- und Verhaltensänderungen zeigt. Besonders häufig sind ältere Menschen (über 65 Jahre) betroffen. Ein Delir kann den Heilungsprozess verschlechtern und bedarf daher besonderer medizinischer und pflegerischer Behandlung.
Um einem Delir vorzubeugen, gilt es einige einfach Dinge zu beachten, z. B.
Zur Orientierung dienen den Patienten eine möglichst feste und sichtbare Tagesstruktur (Kalender und Uhr im Blickfeld), wiederholtes Vorstellen von Pflegenden und Ärzten bei möglichst jedem Kontakt und eine transparente Erklärung der gerade durchgeführten Handlungen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist ebenso wichtig wie die überwachte Einnahme von Medikamenten. ...
- Schaffen einer ruhigen Atmosphäre
- freundlicher und empathischer Umgang
- Förderung der Mobilität
- Bereitstellung von Orientierungshilfen
- uvm.
Delir und Delirprävention Köln | St. Vinzenz-Hospital
Kompetente Betreuung bei Delir & Delirprävention in Köln-Nippes: ✓ Freundlicher Umgang ✓ Ruhige Atmosphäre ✓ Bereitstellung von Orientierungsshilfen!
www.vinzenz-hospital.de
Für den Fall, daß man eine Operation machen lassen muß, kann man sich nur wünschen, daß man in ein Krankenhaus kommt, das über dieses Delir Bescheid weiß und auch personell so ausgestattet ist, daß solche Maßnahmen überhaupt durchgeführt werden können.
Grüsse,
Oregano
- Beitritt
- 17.03.16
- Beiträge
- 3.301
Meine Schwägerin war davon betroffen. Sie erlitt einen Schenkelhalsbruch, wurde umgehend operiert und war nach dem Aufwachen dauerhaft und zunehmend dement. Sie ist letztes Jahr nach einem Schlaganfall verstorben. Zum Glück hatte sie eine Patientenverfügung, so dass sie nicht noch lange sinnlos am Leben gehalten wurde.
Durch den Unfall war keine Zeit für die Vorbereitung und Arztgespräch gewesen.
Durch den Unfall war keine Zeit für die Vorbereitung und Arztgespräch gewesen.
- Beitritt
- 12.05.11
- Beiträge
- 10.068
Ich frage mich, ob Delirprävention nicht schon bei den Narkosetechniken ansetzen müßte. Danach ist das Kind doch in den Brunnen gefallen und das Hirn organisch geschädigt, egal, ob der Patient danach freundlich und empathisch behandelt und ihm/ihr die Orientierung erleichtert wird. Vielleicht ist ein Teil dieser angeblichen Delirprophylaxe in Wirklichkeit nur Verschleierung des angerichteten Schadens.
Sich entwickelnde Demenz nach OP muß auch nicht mit einem Delir einhergehen. Ich habe das Gefühl, das ist in Wirklichkeit noch häufiger als man denkt, weil viele Angehörige und Hausärzte das nicht miteinander in Zusammenhang bringen, da es ja "normal" erscheint, wenn jemand über 70 anfängt, dement zu werden.
Bei meiner Oma war der Auslöser der (sich dann langsam entwickelnden) Demenz nach meiner Einschätzung recht sicher eine OP.
Sich entwickelnde Demenz nach OP muß auch nicht mit einem Delir einhergehen. Ich habe das Gefühl, das ist in Wirklichkeit noch häufiger als man denkt, weil viele Angehörige und Hausärzte das nicht miteinander in Zusammenhang bringen, da es ja "normal" erscheint, wenn jemand über 70 anfängt, dement zu werden.
Bei meiner Oma war der Auslöser der (sich dann langsam entwickelnden) Demenz nach meiner Einschätzung recht sicher eine OP.
- Beitritt
- 04.12.22
- Beiträge
- 433
Meint ihr, beim postoperativem Delir könnte es sich um eine entzündliche Überlastung der (sowieso schon eingeschränkten) körperlichen Entgiftungskapazität und Entzündungskaskaden handeln?
Dementsprechend wäre die erwähnte Studie mit "förderlichem" Paracetamol eine Finte und reine kurzfristige antientzündliche Symptomunterdrückung die das ganze wegen der bekanntlich stark schädigenden Wirkung auf die Leber und das Glutathionsystem möglicherweise nur weiter drückt.
Man bekommt bei Vollnarkosen einen ziemlichen Cocktail von meist >7 Arzneimitteln.
Wären dann gegen postoperatives Delir eine üppige Flüssigkeitsversorgung (Hyperhydration), Koppsche Lösung oder Bicarbonatgaben und NAC mit gleichem Anteil Glycin oder vier Mal täglichen Vitamin C bzw. Natriumascorbat hilfreiche und einfache Gegenmittel?
Vor Allem mit Flüssigkeitsversorgung wird nach OPs drastisch gegeizt. Um jede Flüssigkeitsgabe muss man stundenlang betteln können. Wer zu agitiert erscheint läuft Gefahr mit Beruhigungsmittelgabe abgestellt zu werden, was zur zusätzlichen Belastung beiträgt.
Die Absicht davon ist wohl, die Patienten schnellstmöglich zu "stabilisieren", hinsichtlich Kreislauf und Atmung auf sich selbst zu stellen und die postoperative Überwachung aufs Minimum zu senken. Die Blasenkatetherentfernung erfolgt sofort oder ist auf baldmöglichst vorgesehen.
Wie dann die Nierenfunktionen sind darf man sich ausmalen oder unmittelbar selbst erfahren. Blutwerte gemessen werden üblicherweise in den Tagen nach einer Operation keine.
Peace.
Dementsprechend wäre die erwähnte Studie mit "förderlichem" Paracetamol eine Finte und reine kurzfristige antientzündliche Symptomunterdrückung die das ganze wegen der bekanntlich stark schädigenden Wirkung auf die Leber und das Glutathionsystem möglicherweise nur weiter drückt.
Man bekommt bei Vollnarkosen einen ziemlichen Cocktail von meist >7 Arzneimitteln.
Wären dann gegen postoperatives Delir eine üppige Flüssigkeitsversorgung (Hyperhydration), Koppsche Lösung oder Bicarbonatgaben und NAC mit gleichem Anteil Glycin oder vier Mal täglichen Vitamin C bzw. Natriumascorbat hilfreiche und einfache Gegenmittel?
Vor Allem mit Flüssigkeitsversorgung wird nach OPs drastisch gegeizt. Um jede Flüssigkeitsgabe muss man stundenlang betteln können. Wer zu agitiert erscheint läuft Gefahr mit Beruhigungsmittelgabe abgestellt zu werden, was zur zusätzlichen Belastung beiträgt.
Die Absicht davon ist wohl, die Patienten schnellstmöglich zu "stabilisieren", hinsichtlich Kreislauf und Atmung auf sich selbst zu stellen und die postoperative Überwachung aufs Minimum zu senken. Die Blasenkatetherentfernung erfolgt sofort oder ist auf baldmöglichst vorgesehen.
Wie dann die Nierenfunktionen sind darf man sich ausmalen oder unmittelbar selbst erfahren. Blutwerte gemessen werden üblicherweise in den Tagen nach einer Operation keine.
Peace.
Zuletzt bearbeitet:
- Beitritt
- 17.03.16
- Beiträge
- 3.301
So viel ich weiß, wird daran auch geforscht. Aber bis sich das, was gefunden wird, in allen Kliniken verwirklicht wird, werden wohl noch viele Patienten nach der OP in einer anderen Welt aufwachen.Ich frage mich, ob Delirprävention nicht schon bei den Narkosetechniken ansetzen müßte.
Themenstarter
- Beitritt
- 10.01.04
- Beiträge
- 74.181
Ich denke, daß schon bei den Narkose-Vorgesprächen über mögliche Probleme gesprochen werden sollte (wird?).
Dazu gehört aber dann die Einsicht des Patienten, dass er Empfindlichkeiten hat und es nicht darum geht, möglichst gesund da zu stehen.
Das wird doch leider immer wieder vorgespielt, obwohl diese Haltung schädlich für den Patienten ist, u.a. auch beim Besuch des Med. Dienstes .
Grüsse,
Oregano
Dazu gehört aber dann die Einsicht des Patienten, dass er Empfindlichkeiten hat und es nicht darum geht, möglichst gesund da zu stehen.
Das wird doch leider immer wieder vorgespielt, obwohl diese Haltung schädlich für den Patienten ist, u.a. auch beim Besuch des Med. Dienstes .
Grüsse,
Oregano
Ähnliche Themen
- Antworten
- 19
- Aufrufe
- 5.740
- Antworten
- 1.148
- Aufrufe
- 195.617


